

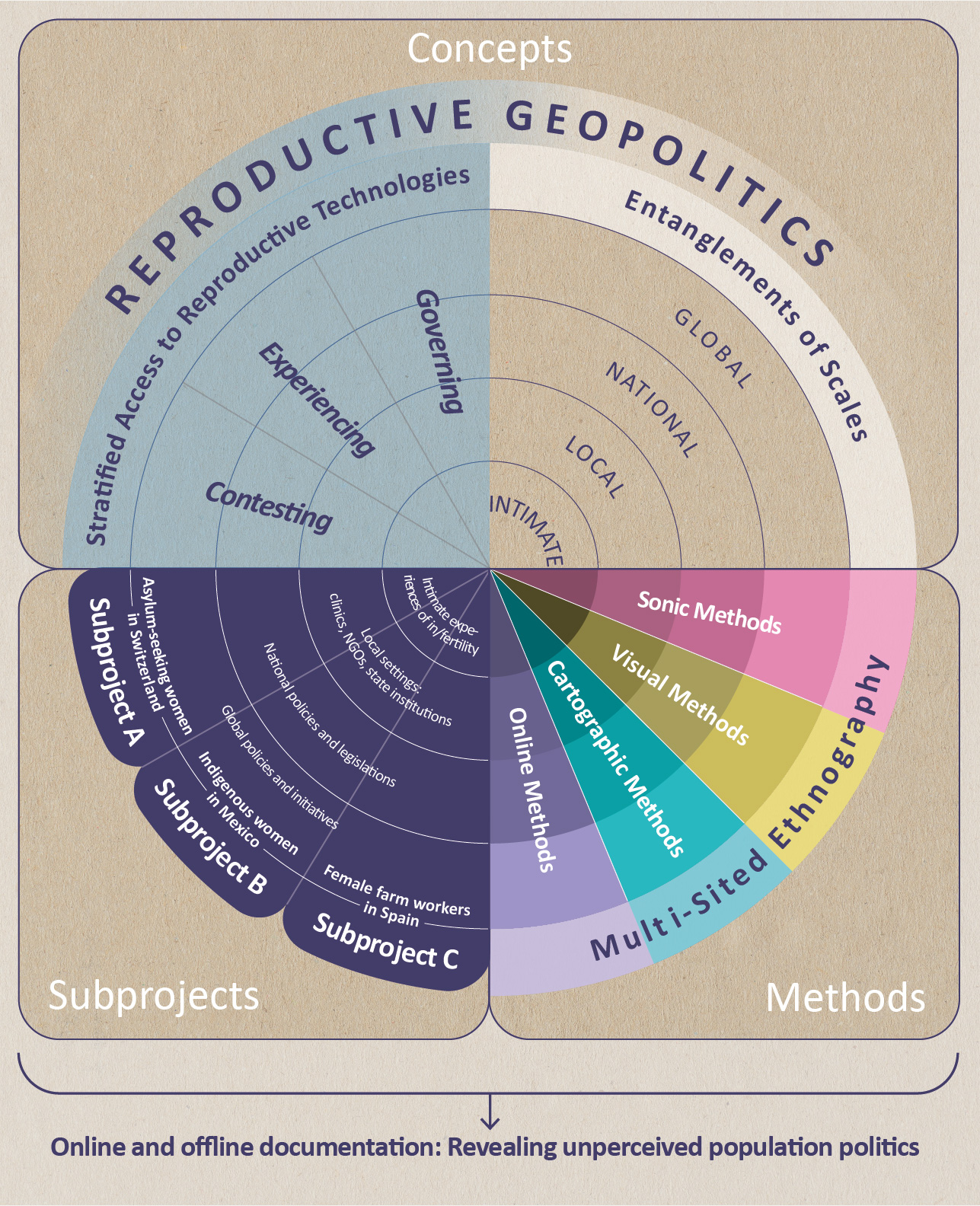





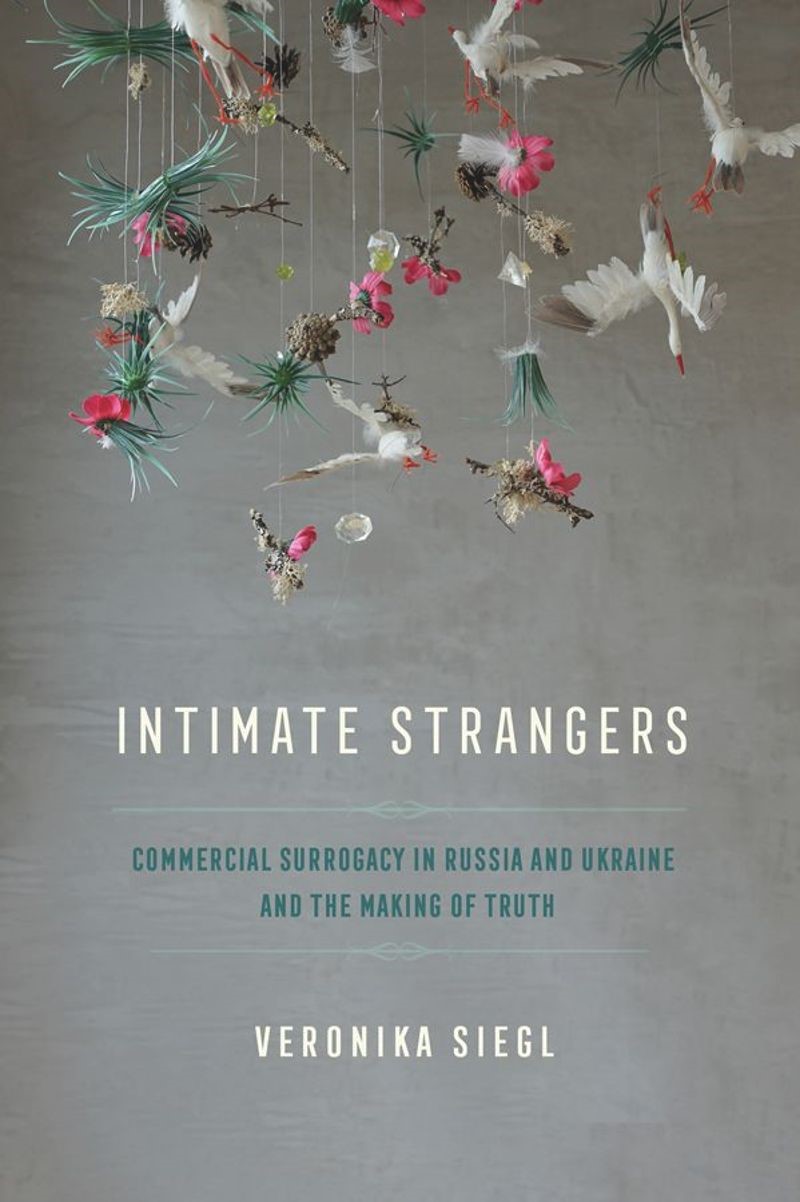


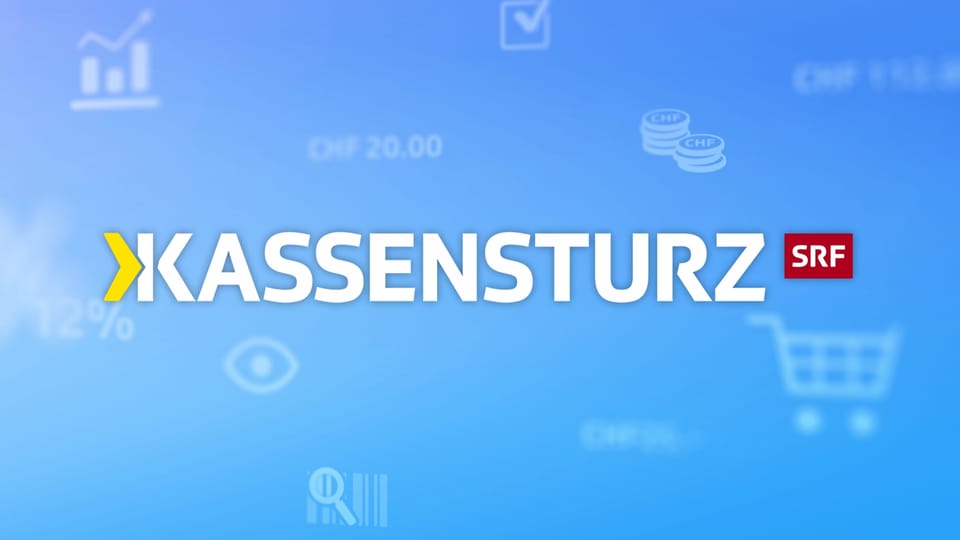

























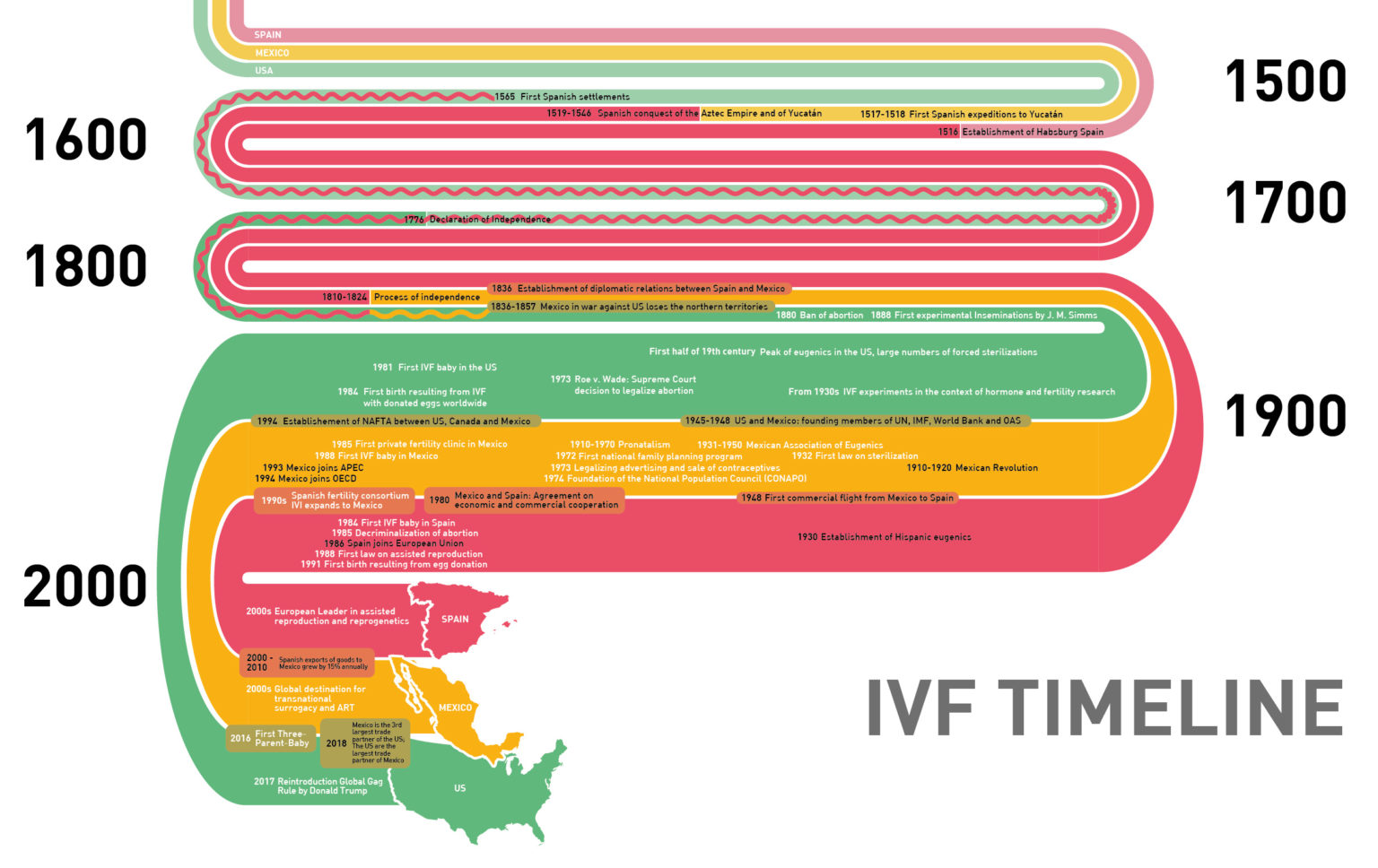



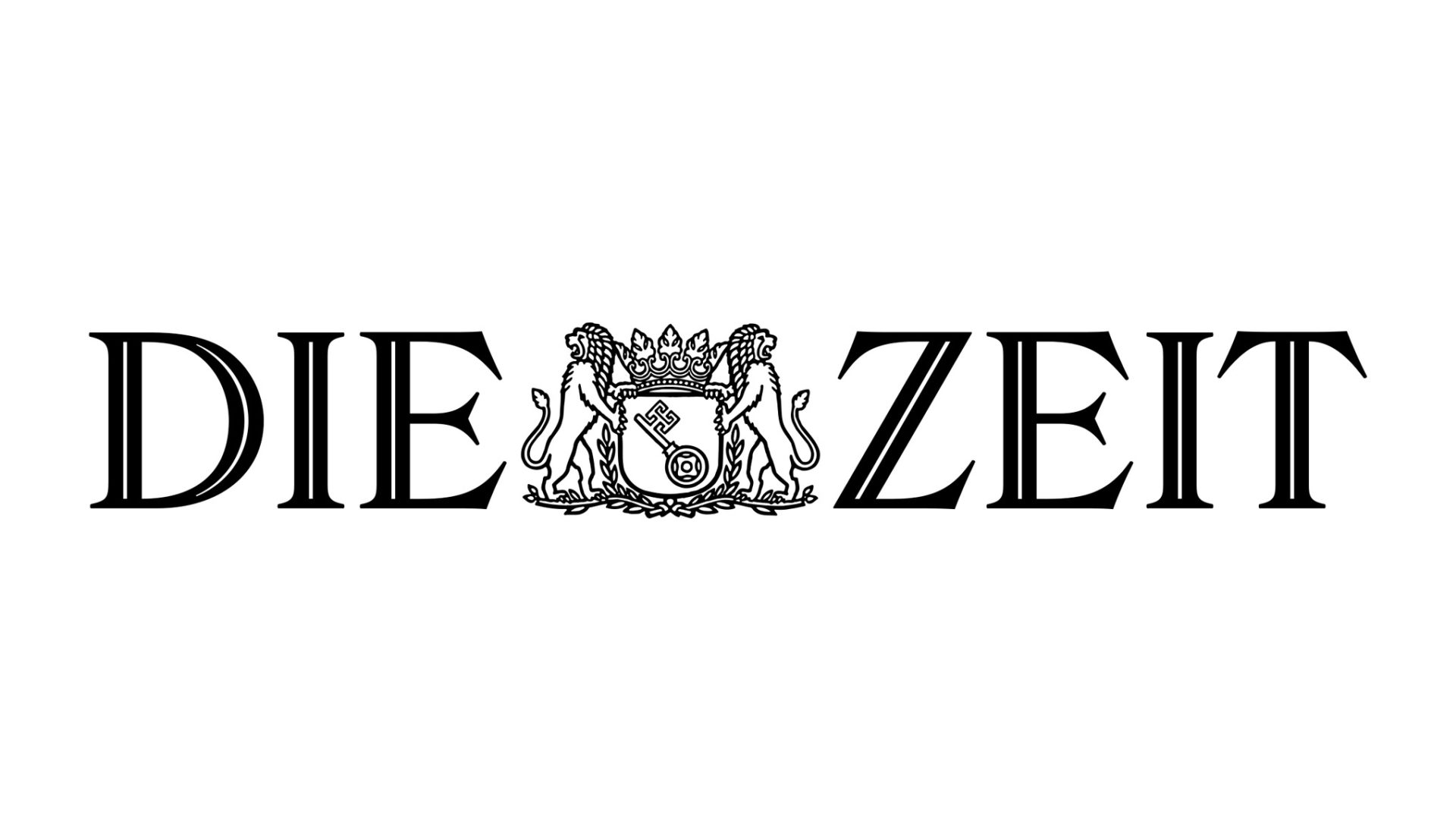








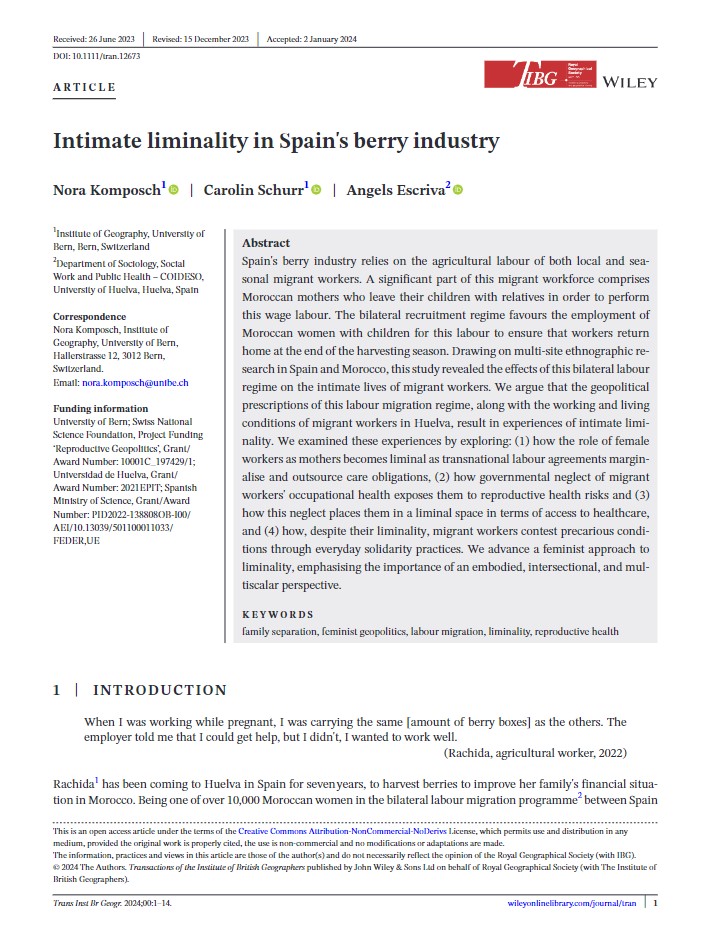


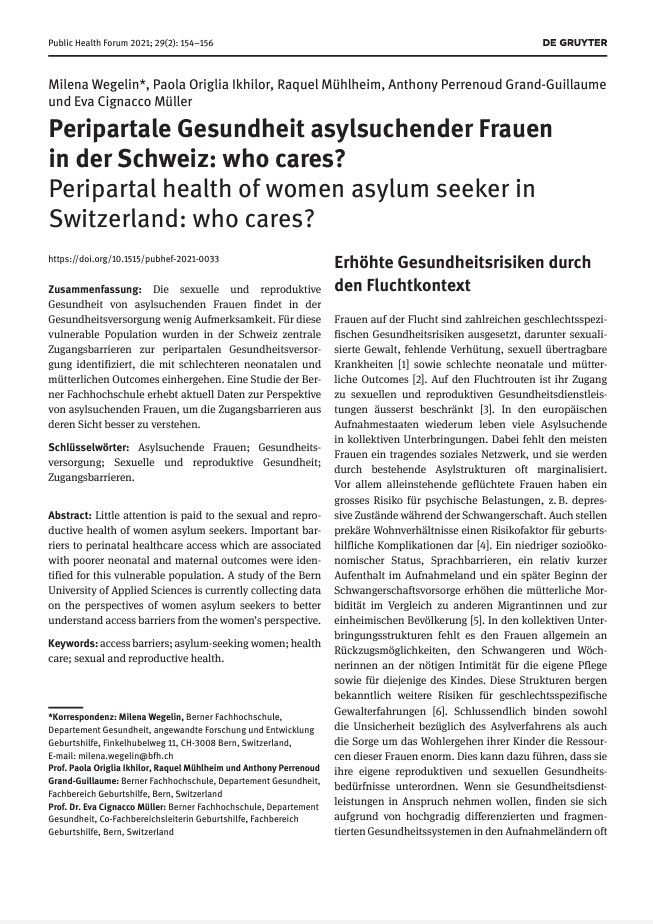
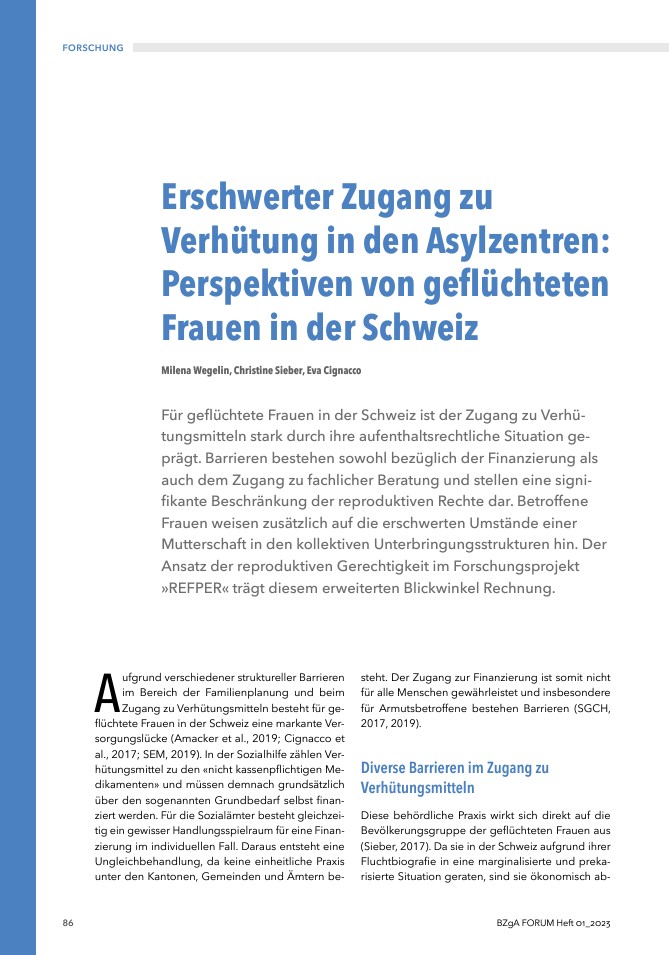
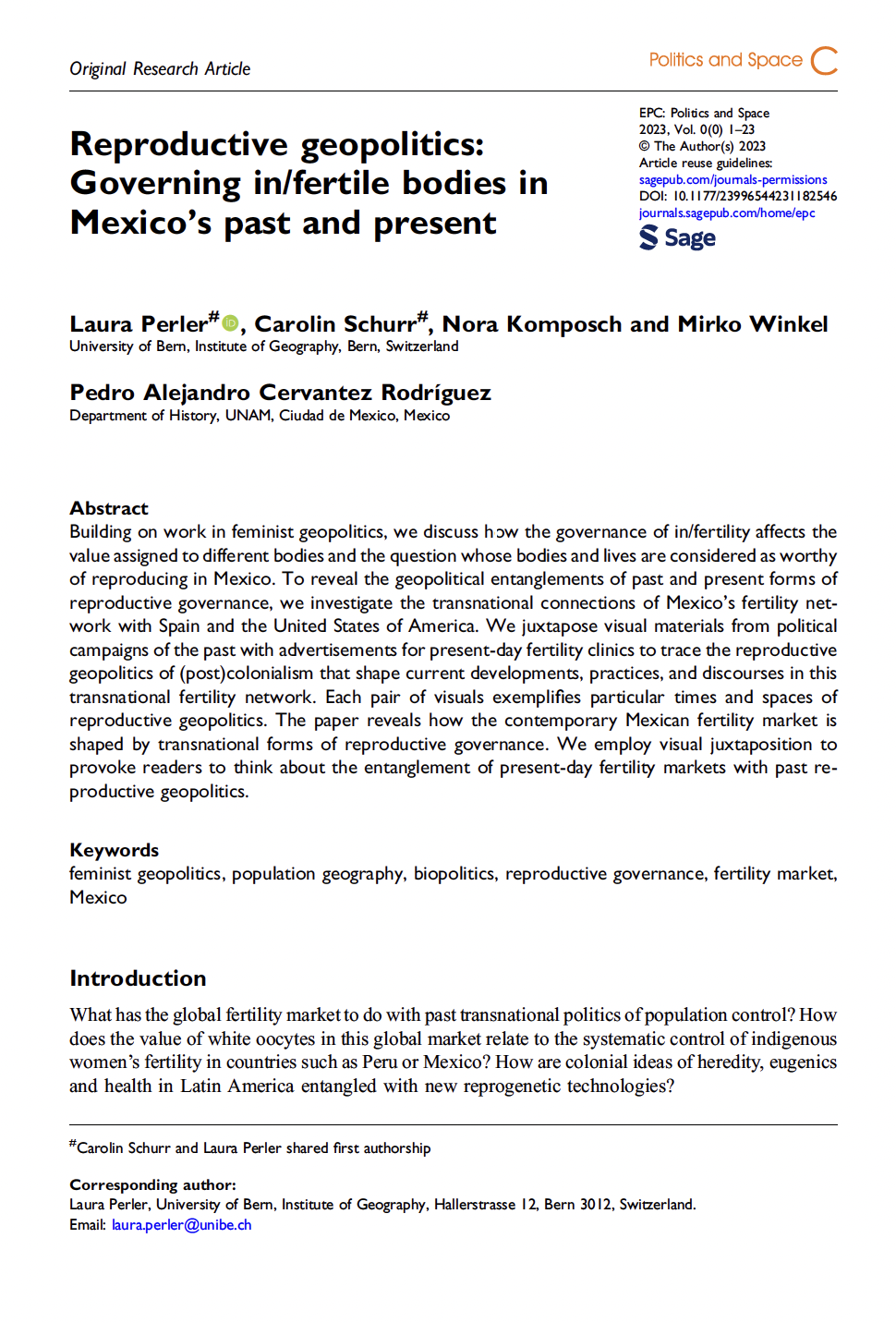
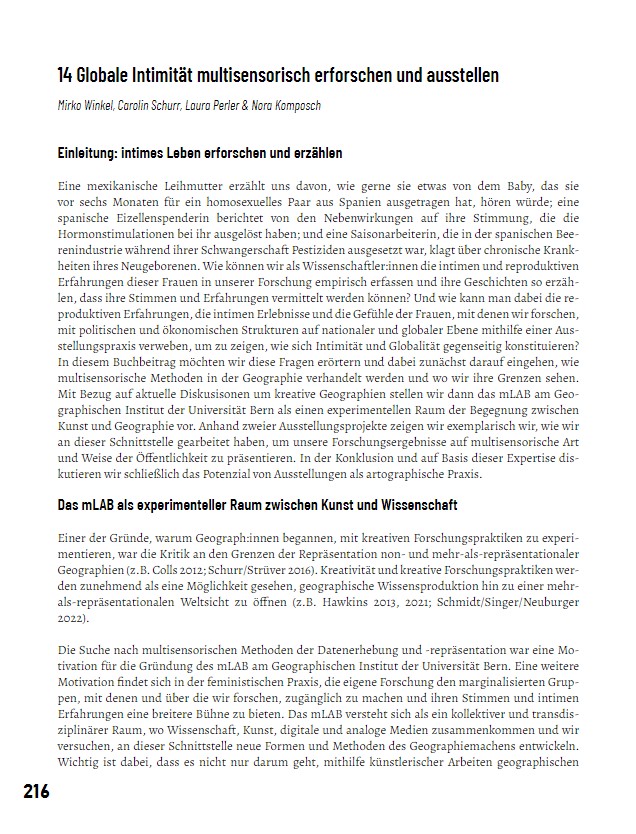
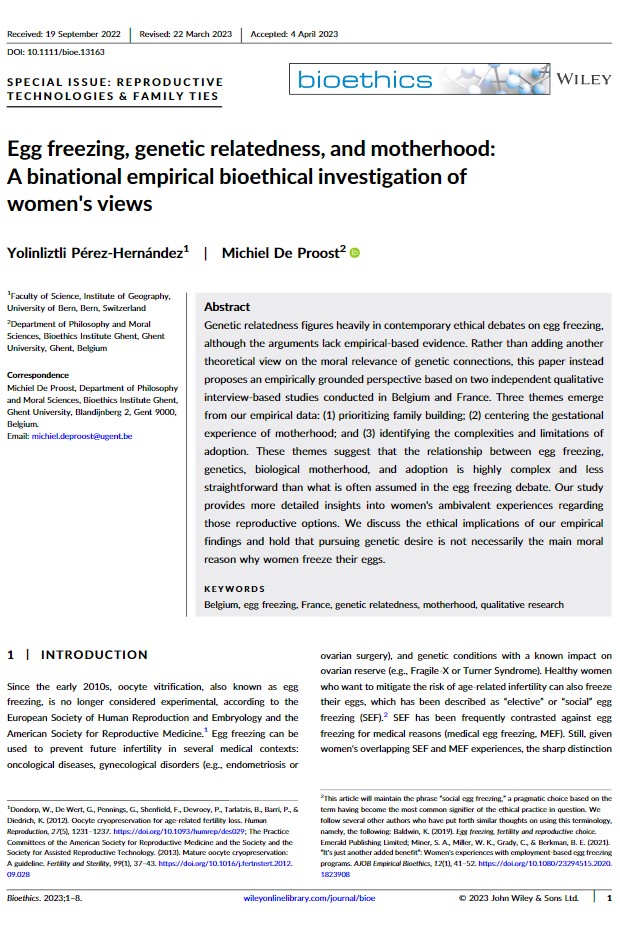




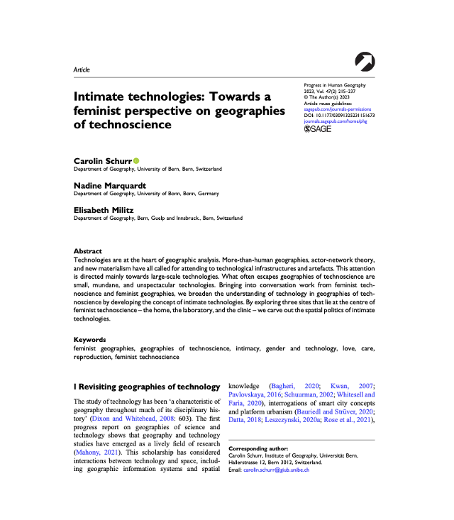
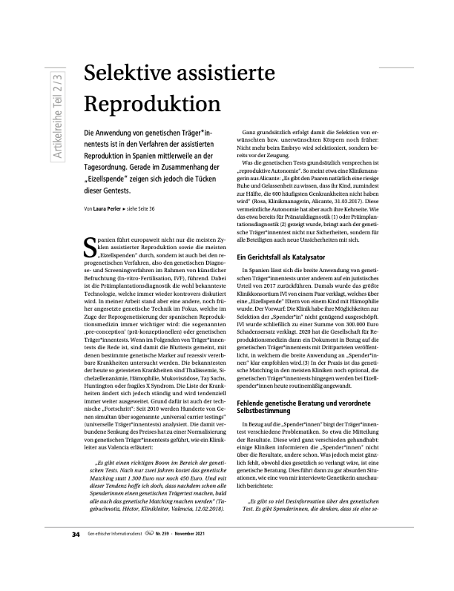




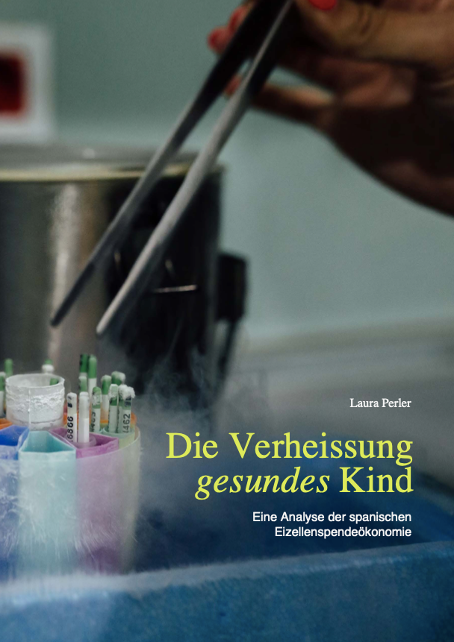
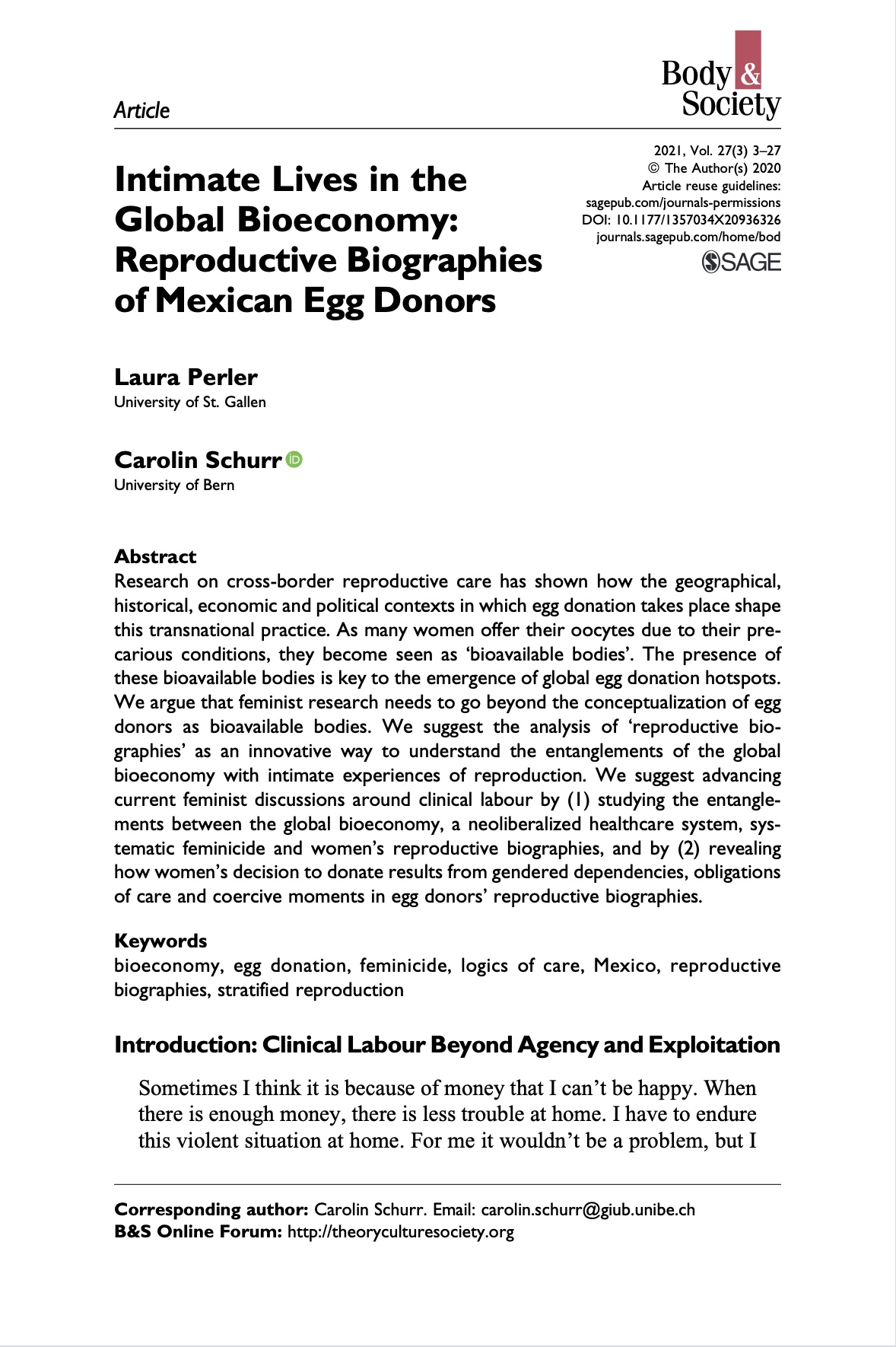

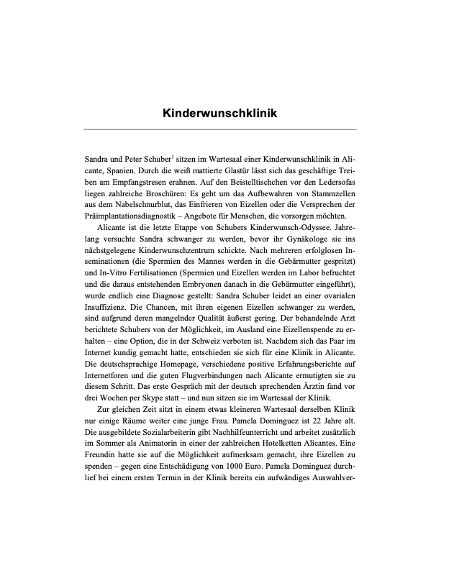

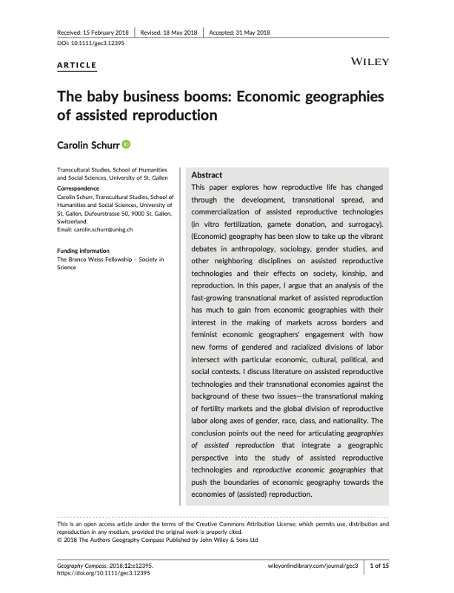

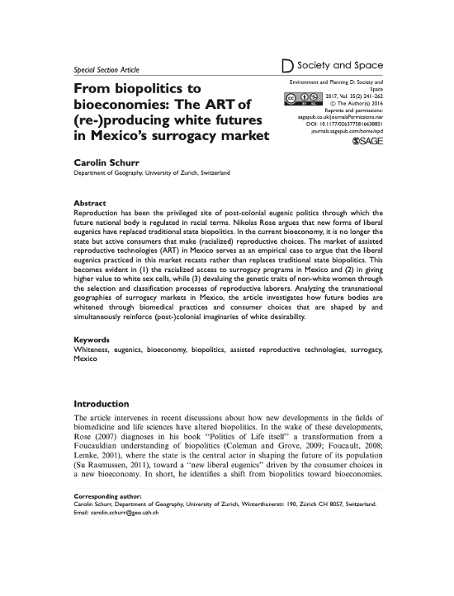
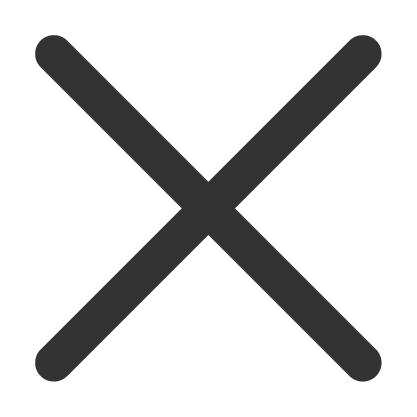

Der Begriff der sexuellen und reproduktiven Gesundheit bezieht sich auf einen Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in allen Aspekten, die mit der sexuellen Funktion, der Fortpflanzung und Beziehungen verbunden sind (UNFPA, 2019). Die sexuelle und reproduktive Gesundheit ist somit ein zentraler Faktor des körperlichen und psychischen Wohlbefindens (Starrs et al., 2018). Sexuelle und reproduktive Rechte beinhalten neben dem Zugang zu adäquaten Unterstützungsangeboten rund um Schwangerschaft und Geburt auch das Recht auf Aufklärung und Information über die sexuelle Gesundheit, das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung, das Recht, über die Anzahl und den Abstand der eigenen Kinder zu entscheiden und das Recht, sexuelle Bedürfnisse zu empfinden und auszudrücken (SGCH, 2017). Diese Rechte bedingen einen Zugang zu Angeboten der Familienplanung sowie zu Informationen und Beratung zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit (EKSG, 2015).
Zugang zu Familienplanungsangeboten ist für geflüchtete Frauen wichtig und wirkt sich positiv auf ihre körperliche und mentale Gesundheit aus. Ein barrierefreier Zugang ist folglich auch für geflüchtete Frauen ein integraler Bestandteil der Gesundheitsfürsorge. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) stellt in seinem Bericht von 2019 fest, dass für Personen in Asylstrukturen der Schweiz eine «umfassende Information über Familienplanung und Verhütungsmittel, die einen selbstbestimmten Zugang zu diesen Mitteln ermöglicht, oft nicht gegeben [ist]» und deklariert in seinem Bericht diese Situation als «signifikante Versorgungslücke» (SEM, 2019, S. 59). Die diesem Umstand zugrundeliegenden Faktoren sind vielfältig und bis heute nicht umfassend untersucht.
Laut dem «World Contraception Atlas» des European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) liegt die Schweiz bezüglich des Zugangs zu Verhütungsmitteln im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld (EPF, 2023). Einer der Hauptgründe besteht darin, dass Verhütung hier als Privatsache gilt und so die faktische Chancengleichheit beim Zugang nicht gegeben ist (Merten, 2023). Während Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse bezahlt werden, müssen die Kosten für Verhütung selbst getragen werden. In der Sozialhilfe gelten Verhütungsmittel als «nicht kassenpflichtige Medikamente» und werden nicht systematisch übernommen, der Entscheid liegt bei der einzelnen Gemeinde. Somit bestehen insbesondere für Armutsbetroffene, zu denen oft Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung gehören, Zugangsbarrieren (Sieber, 2017a).
Diese Tatsachen verweisen auf erschwerende strukturelle Faktoren, welche die reproduktive Gesundheit beeinflussen und im Kontext der gesundheitlichen Ungerechtigkeit eingeordnet werden können. Das Konzept der gesundheitlichen Ungerechtigkeit zeigt auf, wie soziale Unterschiede die Gesundheit beeinflussen (Weber & Hösli, 2022). Im Gegensatz zu gesundheitlichen Ungleichheiten (health inequalities), die biologisch bedingt sind oder freiwillig in Kauf genommen werden, werden sozial bedingte, vermeidbare Unterschiede als gesundheitliche Ungerechtigkeiten (health inequities) bezeichnet.
Im Rahmen des partizipativen Forschungsprojektes REFPER wurde im Kanton Bern basierend auf Interviews die Perspektive geflüchteter Frauen1 auf ihre reproduktive Gesundheit erhoben. Die mit der vorliegenden Studie zugänglich gemachten Erfahrungen geflüchteter Frauen zeigen Aspekte von gesundheitlichen Ungleichheiten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit auf.
Milena Wegelin, Laura Perler, Nour Abdin, Christine Sieber, Lynn Huber, Eva Cignacco (2024) Volltext